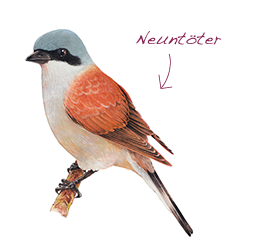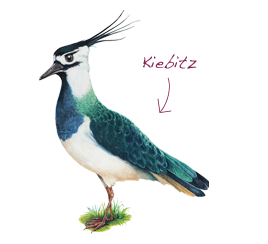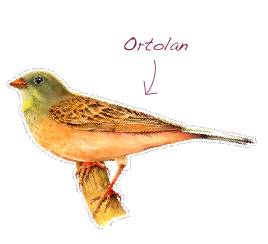Immer mehr Menschen mit Garten oder Balkon wollen den Vögeln etwas Gutes tun und stellen Vogelhäuschen auf. Aber was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Vogelhaus und einem Nistkasten?
Ausschlaggebend ist vor allem der Verwendungszweck. Ein Nistkasten dient, wie der Name es sagt, als Nistplatz oder Überwinterungsmöglichkeit. Er ist meist geschlossen und hat je nach Art der nistenden Vögel unterschiedlich große Einfluglöcher.
Das offen gestaltete Vogelhäuschen bietet den heimischen Vögeln hingegen eine Futterquelle. Vor allem im Winter wird sich hier gerne bedient, aber aufgrund immer weniger wilder Natur und damit einem geringeren Aufkommen an natürlichen Nahrungsquellen, raten Experten zunehmend, auch im Sommer Futter anzubieten. Wichtig ist dabei immer das richtige Vogelfutter und dass es auch bei Regen oder Schnee vor Nässe geschützt ist.
Möchte man seinen Garten zu einem wahren Vogelparadies machen, bieten sich auch Vogeltränken oder Vogelbäder an. In den heißen Sommermonaten haben die Vögel so eine Trinkquelle und können ein kühlendes Bad nehmen.
Egal für welche Option man sich entscheidet, die Vögel freuen sich über Ihre Unterstützung. Ideal ist – bei ausreichend Platz – eine Kombination aus Nistplätzen, Futter- und Wasserstellen. So findet eine brütende Familie alles Nötige in der direkten Umgebung.